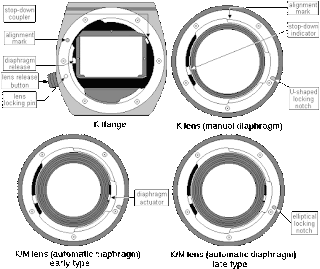Die Contax war 1932 Zeiss Ikon's lang erwartete Antwort auf die schon seit 1925 auf dem Markt befindliche Leica, die sich trotz ihres hohen Preises einer erstaunlichen Beliebtheit erfreute. Fast 80,000 Examplare hatte Leitz trotz der Weltwirtschaftskrise bis dahin verkaufen können und auf der Leipziger Frühjahrsmesse wurde die Leica II präsentiert, mit ein- (oder besser) an-gebautem gekoppeltem Entfernungsmesser.
Zeiss Ikon war ja erst 1926 durch Fusion von Contessa-Nettel, Ica, Ernemann und Goerz unter dem Dach der Carl-Zeiss Stiftung entstanden und nun der bei weitem größte und wichtigste Kamerahersteller. In den ersten Jahren war man zunächst damit beschäftigt, das umfangreiche Kamerasortiment zu konsolidieren, um sich nicht selbst weiter intern Konkurrenz und Platz für Neuentwicklungen zu machen. Als Leica-Alternative kam zunächst (1930) die Kleinfilmkamera Kolibri, dummerweise waren auch viele andere Hersteller gleichzeitig auf die Idee mit dem Halbformat 3x4 auf dem 127er Rollfilm gekommen, so dass der Markt etwas übersättigt mit solchen Kameras war. Außerdem war eine "echte" Leica-Alternative gefragt, die auch noch besser sein sollte...
Zeiss Ikon investierte also ab 1929 in deren Entwicklung, schickte das junge Ingenieurstalent Heinz Küppenbender nach Dresden und machte ihn zum Chef eines größeren Entwicklerteams. Heraus kam die Contax, leider nicht mehr rechtzeitig zur Frühjahrsmesse im März 1932. Erste Exemplare waren wohl ab dem Sommer zu haben. In der Papierform war sie tatsächlich in vielen Belangen der Leica überlegen und wurde entsprechend auch teurer verkauft. Allerdings war sie bei ihrem Erscheinen 1932 noch nicht wirklich fertig. Man kämpfte mit einigen Kinderkrankheiten, die ersten Produktionsserien wurden zum Teil nochmal komplett überarbeitet, was man den AU- und AV-Seriennummern heute ablesen kann. Sammler unterscheiden 6 (McKeown, Typen a-f) oder 7 Versionen (Kuc, s.u.) mit kleineren oder größeren Änderungen, die bei laufender Produktion zwischen 1932 und 1935 implementiert wurden. Die beiden wichtigsten sind die Einführung des Viergruppenverschlusses (mit Langzeitwerk ab ½ s, ab Typ c bzw. Version 4, ca. Frühjahr 1933) und der Drehkeilentfernungsmesser (davor Spiegel, ab Typ e, V. 6, ca. Herbst 1934).
Erst gegen Ende 1935 war die finale Version 7 (Typ f) auf dem Markt und eine solche habe ich hier vor mir (Seriennummer Z27153). Alle weiteren Verbesserungen flossen von da an in die Nachfolgerin Contax II ein, die im Frühjahr 1936 erschien, endlich die fast perfekte Alternative zur Leica (nun III) war und nicht mehr wesentlich bis zum Ende ihrer Produktion verändert wurde. Die ursprünglich nur Contax genannte Kamera hatte im Jahr 1936 noch einem letzten Produktionsblock (Seriennummern A20xxx), blieb bis 1938 im Zeiss Ikon Katalog und hieß nun Contax I. Anscheinend gab es noch erkleckliche Lagerbestände!
 |
 |
 |
Mein Exemplar ist äußerlich in einem sehr abgenutztem Zustand. Ein Vorbesitzer hat sich irgendwann sogar die Mühe gemacht, die ursprünglich schwarz lackierten Kanten bis aufs Aluminium abzuschmirgeln. An anderen Stellen blinkt Messing durch und die ursprünglich roten und weißen Beschriftungen sind nur mit viel Wohlwollen noch als jetzt beige-rotbraun und beigebraun zu erkennen. Der ausklappbare Standfuß fehlt und der Rückspulknopf ist nicht mehr der originale. Aber ansonsten kann ich mich nicht beschweren - die Kamera funktioniert: Der Verschluss läuft auf allen Zeiten plausibel, die 1/100 Sekunde habe ich stellvertretend mal mit dieser Methode nachgemessen. Auch der Entfernungsmesser geht noch (dank Drehkeil!) und der mit dem Zeigefinger zu bedienende Fokus-Schneckengang ist super leichtgängig. Einem Testfilm stände also nichts entgegen...
 |
 |
 |
Nun war ich natürlich neugierig, wie erfolgreich Zeiss Ikon mit ihrer Contax I wirklich war, sprich wieviele Exemplare gebaut und schließlich verkauft wurden. Die Antwort darauf war schwieriger zu bekommen, als ich gedacht hatte für so eine bekannte und auch bedeutende Kamera. Nirgendwo in den Weiten des Internets habe ich diese Zahl gefunden. Am nächsten dran kam ich mit einem Artikel aus dem Journal der Zeiss Historica Society, der allerdings nur auf das Buch "Auf den Spuren der Contax, Band 1" von Hans-Jürgen Kuc (Wittig Verlag 1992, ISBN 3-88984-118-X) verweist. Also habe ich mir das Buch in einem Antiquariat bestellt und mir die Wartezeit darauf dadurch verkürzt, dass ich mich selbst per Seriennummernsuche an die Arbeit gemacht habe.
Und tatsächlich habe ich bei e-bay und anderen Seiten im Internet knapp über 100 Contax-I-Seriennummern finden können. Die Analyse wird dadurch erschwert, dass Zeiss Ikon keine separate Nummer nur für die Contax hatte, sondern sich alle Kameras einen Nummernkreis teilen. Allerdings wird einem beim Betrachten der Zahlen schnell klar, dass es Produktionsblöcke mit fortlaufenden Nummern gegeben haben muss, im Falle der Contax waren es 25 Blöcke, von denen ich mit meiner Analyse schon 23 gefunden habe. Ca. 100 Kameras als Stichprobe bei 25 Blöcken, gibt im Schnitt nur 4 Kameras pro Block und einen entsprechend großen Schätzfehler. Meine Analyse hat tatsächlich ca. 30.000 Kameras (+/- 5.000) ergeben.
Als dann das Buch vor ein paar Tagen kam, war ich sehr angetan. Die dort verwendete Stichprobe war ca. 5000 Kameras groß und die Schätzung von insgesamt 36.700 Kameras entsprechend viel genauer als meine. Eine Fehlerabschätzung macht Hans-Jürgen Kuc leider nicht, weist aber sehr solide auf mögliche Fehler hin. Das Buch ist tatsächlich eines der besten Photographica-Bücher, die ich bisher in die Finger bekommen habe. Ein echtes Standardwerk zu Contax und Co. Ich habe mich also entschlossen hier nicht alles widerzukäuen, was sowieso im Internet zu finden ist (Achtung: nicht alles dort ist richtig!), sondern zur Abwechslung mal auf dieses Buch zu verweisen, es lohnt sich für alle, die an Details (Technik und Geschichte) interessiert sind. Das Buch gibt es übrigens auch in einer Englischen Version...
| Datenblatt | Frühe Kleinbildkamera für perforierten 35mm Film mit Wechselobjektiven und Entfernungsmesser |
| Objektiv | Contax Wechselbajonettfassung mit kameraseitigem Schneckengang für 50 mm Objektive (Innenbajonett), sowie Außenbajonett für alle anderen Brennweiten (mit eigenem Schneckengang). Als Standardobjektive 5cm verfügbar: Tessar f/3.5 und f/2.8, Sonnar f/2 und f/1.5. |
| Verschluss | Vertikal ablaufender Metallrollo-Schlitzverschluss, Zeiten in vier Gruppen wählbar: B und 2; 5 und 10; 25-50-100; 100-200-500-1000 (1/s). Frühe Kameras bis Frühjahr 1933 hatten noch die einfache Version mit B-25-50-100-200-500-1000. Ein Upgrade wurde für 30 RM angeboten, die neue Version kostete auch 30 RM mehr. |
| Gehäuse | Metall-Druckguss aus Silumin (Al-Si-Legierung), komplett abnehmbare Rückwand zum einfachen Filmhandling und Austausch gegen Zubehör. |
| Fokussierung | Eingebauter gekuppelter Entfernungsmesser, Fokussierung mit dem rechten Zeigefinger per (Unendlich-) arretierbarem Drehrad. Bis 1934 mit Schwenkspiegeltechnik und großer Basis von 10,3 cm. Danach per Drehkeiltechnik, Basis nun 93 mm. |
| Sucher | Optischer Fernrohrsucher (getrennt vom benachbarten Entfernungsmesser-Einblick), vorschiebbare Suchermaske (s.u.) |
| Zubehör | Umfangreiches Zubehör verfügbar, siehe Katalogseiten unten. Kamera gilt als eine der ersten Systemkameras. |
| Filmtransport | Mittels kombiniertem Drehknopf auf der Kameravorderseite, der gleichzeitig den Verschluss spannt und direkt über dem Zeiteneinstellrad liegt. Film wird entweder von Patrone zu Patrone transportiert, oder zurückgespult nach Filmende. Bildzählwerk auf der Kameraoberseite. |
| sonst. Ausstattung | Zubehörschuh, Drahtauslöseranschluss, 3/8“ Stativgewinde, Ösen für Kameragurt, Unendlich-Ver/Entriegelung per Schieber neben Fokusrad, automatische Entriegelung für Außenbajonettobjektive, Suchermaske für Teleobjektiv (meist für 8,5 cm, optional auch 13,5 cm), ausklappbarer Standfuß. |
| Maße, Gewicht | ca. 45 x 70 x 135 mm, 570 g (ohne Objektiv). |
| Baujahr(e) | 1932-1936, im ZI-Verkaufsprogramm bis 1938. Diese # Z27153 von Ende 1935. Insgesamt maximal 36.700 Kameras (Kuc), davon ca. 15.000 dieser Version 7 bzw. "f". |
| Kaufpreis, Wert heute | 365 RM (1935, mit Sonnar f/2), heutiger Wert je nach Version und Zustand ca. 400 - 2000 € |
| Links | Camera-Wiki, Wikipedia, Cameraquest, Pacificrim, Deutsches Kameramuseum (Kurt Tauber), Altglasfieber, Zeiss Historica Q3-1993, |
| Bei KniPPsen weiterlesen | Contax II, Kiev 4, Leica Ia, Leica III, Beira, Peggy, Retina, Super- Nettel, Tenax II, Kolibri, andere Vorkriegs-Kleinbildkameras, andere 3x4-Kameras |

|

|
| Seiten aus den Photo Porst Katalogen von 1932 (links) und 1935 (rechts). Klick auf die Grafik führt zu weiteren Seiten als PDF... | |